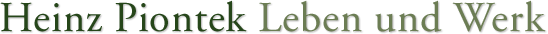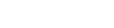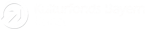Riederau am Ammersee
1967
Der Neubau (mit 40 schlechtisolierten Mietwohnungen), den Pionteks nun schon eine Weile bewohnen, erweist sich als nur mäßig geeignet für einen Autor, der es hauptsächlich mit konzentrierter und komplizierter Schreibarbeit zu tun hat. Da das Wohnhaus auch noch in nächster Nahe der Riesenbaustelle für die olympischen Sportstatten liegt, rollt ein nicht geringer Teil des gesamten Bauverkehrs Tag und Nacht unter den Fenstern vorüber. Daß es noch schlimmer werden wird, ist abzusehen. Frau P. schaut sich nach einer zweiten Wohnung auf dem Land um. Und sie hat Glück. Am Ammersee in Riederau (Diessen) entdeckt sie eine bequeme Etagenwohnung in einem Zweifamilienhaus, das einem Imkerehepaar gehört. Die Wohnung kann bereits im Oktober angemietet und im Dezember bezogen werden.
(Aus: Wirkungsgeschichte eines schreibenden Einzelgängers Bd.2, hrsg.v. Ludwig Steinherr, Selbstverlag, 2000, S.1071-1072)
Zwischen 1968 bis 1981 also verbrachte Heinz Piontek alljährlich einige produktive Monate in Riederau am Ammersee. Hier entstand u.a. sein zwölfteiliger Gedichtzyklus „Riederauer Gedicht“, und hier spielten auch einige Kapitel aus dem Roman „Dichterleben“. Heinz Piontek schildert seinen Rückzugsraum, sein Idyll als Quelle der Inspiration. Der Raum selbst wird poetisch zum Leben erweckt.
Die Dachstube
Seit zwölf Jahren habe ich neben meinem Münchner Arbeitszimmer auch eines auf dem Lande. Es ist acht Meter lang, vier Meter breit, um die Zimmerdecke zu berühren, brauche ich mich nur auf die Zehenspitzen zu stellen. Also ein Dachzimmer.
Die Mehrzahl mit mir befreundeter Kollegen arbeitet zwischen schrägen Wänden und schaut zwischendurch aus Mansarden - oder Giebelfenstern. Ungern tragen wir Profis mit unserer Vorliebe für hochgelegene Raume zur Verewigung des Spitzweg-Klischees bei. (Arme Poeten rakeln sich heute in Sozialwohnungen oder richten sich abbruchreife Bauernhäuser schick her.) Unterm Dach ist es halt immer noch am ruhigsten im Haus. Und wer fünf bis acht Stunden täglich oder gar mehr unentwegt auf weiße Blätter mit seiner eigenen Handschrift starrt, möchte zuweilen ganz gern einmal seine Augen an möglichst weiten Ausblicken erfrischen oder ihnen zur Abwechslung die Licht- und Wolkenspiele in der himmelhohen Arena bieten.
Sicher gibt es noch andere Gründe für die Zweckmäßigkeit von Schriftstellerstudios direkt unter den Dachziegeln - doch gründliche berufspsychologische Erwägungen über die Arbeitsplätze der Autoren von Profession will ich hier nicht anstellen.
Mein Zimmer verdient noch den alten Namen Stube; ich kann und mag sie nicht zu einem dekorativen Studio hochstilisieren. Selbst nach zwölf Jahren haftet ihr noch immer etwas Provisorisches an. Beim Ein-zug habe ich sie mit ein paar Möbeln, zumeist aus den 50er Jahren, und einem (unverwüstlich intakten) Dampfradio nebst Plattenspieler aus derselben Epoche eingerichtet Vorübergehend, glaubte ich. So sind auch der lange Arbeitstisch, die Bücherregale, der Rollschrank keine Kostbarkeiten.
Aber der Tisch ist mir inzwischen lieb geworden, denn er steht dicht unter dem kleinen altmodischen Fenster, durch das ich auf nahe und ferne Baumwipfel blicke und auf die sich dehnende, wandelbare blaue Atmosphäre. Halt, eben erinnert mich das Zwölfuhrläuten, daß ich am Rand meines Blickfeldes gerade noch eine patinierte bayerische Turm-zwiebel zu Gesicht bekomme. Als Wetterhahn dient ihr ein auf der Stelle fliegender Engel.
Ja, der Tisch ist die Hauptsache, denn er hat nicht nur genügend Platz für Papiere, Mappen, Bücher, die Schreibmaschine, ich kann auf ihm auch eine beträchtliche Landefläche für Gedanken freihalten, für ballonleichte Bilder, Schwärme von Sätzen und Versen oder für ständig herbeigesehnte, manchmal vereinzelt niedergehende unbekannte Flugobjekte, die sich dann als überraschende Worteinfälle her-ausstellen, doch einen Hauch ihrer geheimnisvollen Herkunft behalten. Mehr als die Hälfte meiner über dreißig Bücher habe ich hier ausgeheckt, an ihnen getüftelt, wahrend mein Sitzfleisch zäh wurde und die Nerven sich verschlissen.
Wandere ich auf Gummisohlen lautlos die vollen acht Meter hin und her, bleibe ich zuweilen vor einem Blatt an den Wänden stehen. Was habe ich nicht alles festgepinnt! Eine Generalstabskarte meines Heimatkreises Kreuzburg O. S. (heute polnisch: Kluczborg oder so ähnlich), einen Grieshaber, eine Barockvedute vom schönen Graz. Dazu reihenweise englische Reiterphotos. Während ich jetzt pausiere, betrachte ich die Wiedergabe eines Steinbildes vom Brixener Dom: Es ,,verewigt" den Wolkensteiner Oswald, den ersten neuhochdeutschen Poeten, der mir besonders lieb ist.
Außerdem besitze ich noch eine Art Schwarzes Brett, auf dem ich festzwecke, was mich bloß vorübergehend anzieht (oder erheitert). Kafkas und Goethes Schriftzüge. Oder ein Photo von Heidegger und Augstein, die einträchtig bergan gehen, der Philosoph mit einem simplen Rucksack, der Spiege/-Herausgeber mit Aktentasche. Hübsch finde ich gegenwärtig das Schlafzimmer der Herzogin von Parma auf einer farbigen Zeichnung.
Kunterbunt sieht es bei mir allerdings nicht aus. Wände und Plafond sind weiß getüncht; ein brauner Deckenbalken verleiht der Stube etwas Rustikales. Gar nicht schlecht passen die rot-weißen Gardinen dazu sowie der kleine Teppich (eine Handarbeit der fünfundsiebzigjährigen Mutter des Dichters). Dennoch, ein stilvoller Arbeitsraum ist es nicht geworden. Mir jedenfalls behagt er. Zum Lesen setze ich mich in einen Lehnstuhl, das beste Stuck hier, das von einer Qualität zeugt, wie man sie heute nur schwerlich kriegen dürfte. Und bei kalter Witterung gleicht, leise donnernd, ein Ölofen den Temperaturabfall aus. An gewissen Tagen - ich will nichts idyllisieren - donnert es draußen so, daß das Haus bis in seine Fundamente erzittert Die in einem nahen Horst stationierten Düsenjäger moderns-ten Typs durchbrechen die Schallmauer. Nachts ist es still wie in alten Kalendergeschichten.
Ich bin sicher, außer den vier Wänden, zwischen denen der Schriftsteller arbeitet, weiß niemand genau, was es heißt, Tag für Tag sein Pensum zu schreiben, und was sich dabei im Lauf vieler Jahre so abspielt Denn wer hat je einem arbeitenden Autor auch nur wenige Stunden aufmerksam zugesehen? Also: Befragt meine Wände! Ich verrate nichts.