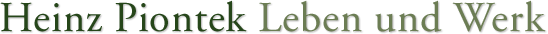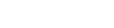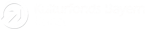Kurzinterpretation: Mit dreißig Jahren
Mit dreißig Jahren (Heinz Piontek)
Keine sichtbaren Narben
keine Medaillen,
keine Titel -
aber das Auge scharf, unbezähmbar
wie Zorn und Entzücken,
dicht die Erinnerung
und leicht der Schlaf.
Fahrten, Märsche vor zwanzig.
Nachher genügten vier Wände:
Wir werden nicht
überschaubarer unterwegs.
Oft reichen drei Schritte.
Und immer genügt
weniger als wir vermuten.
Zum Beispiel die Stadt.
Man kann sie umwandern
in einer einzigen Stunde.
Ihre Steige bröckeln,
in den Türmen haust
die blinde Geschichte.
Helle von Silberkörnern,
wenn die Flussnebel fallen …
Mühsal ist wirklich
Last und Hitze,
das Glück der Todmüden.
Wirklich der überwundene Tod –
und was vergeblich war, wird
fest unter den Sohlen.
Mehr wissen wir nicht.
Erwachet früh -
wenn der Morgen
mit halben Farben erscheint
und satt das Holz leuchtet,
das geteert ist -:
denn der Wind steht gegen euch!
Doch sputet euch nicht.
Wir leben gezählte Tage.
für Gisela
Kurz nach seinem dreißigsten Geburtstag trug Heinz Piontek in die seit 1954 ununterbrochen geführten „Täglichen Notizen“ am 21.2.1956 in Dillingen ein: „Bleibe bei der Lyrik. Heute in einem Zug 'Mit dreißig Jahren'“ Die erste Buchveröffentlichung des seiner Frau Gisela gewidmeten Gedichts erfolgte dann in dem Band „Wassermarken“ (Esslingen 1957).
Es handelt sich um eine Art lyrisches Selbstporträt. Die dritte Strophe – neben der Schlussstrophe besteht sie als einzige aus acht Zeilen – stellt dabei die „Mitte“ des Gedichts dar, nicht nur als Median, sondern vor allem auch als inhaltliches und thematisches Zentrum, in dem die in I und II gezogenen Linien gleichsam zusammenlaufen und die Grundlage für die in den beiden letzten Strophen zur Sprache kommenden Gewissheiten gelegt werden.
In der ersten Strophe umreißt der Sprecher seinen augenblicklichen Zustand und seine Befindlichkeiten. Aus dem Krieg, an denen er in einem Alter „vor zwanzig“ teilnehmen musste und der ihn, wie wir biographisch wissen, nach Südfrankreich, an die Ostfront und schließlich in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft im Bayerischen Wald führte, ist er ohne „sichtbare Narben“, ohne körperliche Schäden also, aber auch ohne Orden und Beförderungen zurückgekommen. In diesen „Fahrten und Märschen“ aber erwuchs ihm eine geschärfte, auf Grund seines hohen emotionalen Erregtseins („Zorn“ - „Entzücken“) nicht bezähmbare Wahrnehmungsfähigkeit. Mitgebracht hat er zudem eine Reihe „dichter“, soll heißen: zusammengedrängter Erinnerungsbilder. Und einen „leichten Schlaf“, aber wie sollte es auch anders sein, denn [der] „halblaute Terror durch überheizte Baracken, / Verhöre um Mitternacht, Erschossene in hallenden Kellern – / das alles konnt' ich vergessen. // Doch jetzt belagert es mich, murmelnd und tückisch. / ...“ (Vergängliche Psalmen, 1953). Die zweite Strophe des Gedichts wird bestimmt von der Spannung der durch den Krieg erzwungenen Bewegungen in die Weite des Raums („Fahrten und Märsche“), und von der nunmehr als notwendig erachteten Beschränkung auf engen Raum, auf „vier Wände“, „drei Schritte“. Diese B e grenzung wird gegenüber der vorausgegangenen E n t grenzung aber nicht als Behinderung oder Erschwerung gesehen, sondern als eine für die jetzige Lebenssituation gebotene Notwendigkeit, sich selbst überschauen zu müssen. Durch den zweifachen Gebrauch des entsprechenden Verbums „genügen“ wird dies unterstrichen. Das Erlebnis des Krieges bleibt der zeitliche und damit auch der lebensbestimmende Bezugsrahmen: „vor zwanzig“ – „nachher“.
Wenn der Sprecher im Krieg auch vieles sehen konnte, sich selbst aber ist er nicht „überschaubarer“ geworden. Für eine Reise nach Innen reichen nun in der kleinen Stadt, wo er eine neue Heimat gefunden hat, „vier Wände“ eines möblierten Zimmers. Es befand sich im Galgenbergviertel (Gundelfinger Straße 9, heute Nr. 30), in dem er von 1949 bis zu seiner Heirat im Juni 1951 wohnte. Eine eremitische Klause – in einem Gedicht von 1950 heißt es „Kittbrösel auf dem Simse. / Vieles bleibt ungewiss. / Was ich am Fenster ersinne, / webt die einsame Spinne / in den Gardinenriss“ („Das Fenster“,1950) – wird zum Schreibort der frühen Erzählungen und Gedichte, von denen einige der Stadt und der Flusslandschaft gelten („Die Turmstube“, „Die Furt“, „Fischerhütte“, das früh bekannt gewordene und anthologisierte „Lauingen an der Donau“). In „Mit dreißig Jahren“ wird Lauingen zwar nicht mit Namen genannt, die dritte Strophe aber umreißt es mit wenigen Worten: „Türme“ (der Schimmelturm, der Mauerturm am Oberanger, die Stadtpfarrkirche St. Martin, das Herzogsschloss mit Turm, die Stadtmauer), „bröckelnde Steigen“ (von der Brüstungsmauer der aus der Stauferzeit stammende Stadtbefestigung führen steile Wege und Treppen zum Fluss hinunter) und schließlich die Donau mit „fallenden Flussnebeln“. In den Türmen der Stadt aber „haust die blinde Geschichte“: Die politischen, militärischen und wirtschaftlichen Vorgänge, die den Inhalt von Geschichte ausmachen, vollziehen sich gleichsam hinter dem Rücken der Menschen und sind blind für individuelle Schicksale. Das in diesem Zusammenhang gebrauchte Zeitwort „hausen“ hat hier die Bedeutung von „Verwüstungen anrichten“: Geschichte als Zerstörung: d i e Erfahrung der Generation Heinz Pionteks!
Die beiden letzten Strophen wenden sich dann dem zu, was vom Sprecher in seinen „vier Wände[n]“ als „wirklich“, gemeint im Sinne von tatsächlich, begriffen wurde. Man hört in den ersten drei Zeilen der Strophe IV, in Worten wie „Mühsal“ und „todmüde“, ein Echo auf Martin Luthers Übersetzung des 90. Psalms: „Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühsal und Arbeit gewesen; denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon“. „Wirklich“ im Sinne einer heilsgeschichtlicher Tatsache (d, h. nicht nur als Bild oder Symbol), ist für den Sprecher vor allem der durch die Auferstehung Christi „überwundene Tod“, ein beherrschendes Motiv der Sterbe- und Ewigkeitslieder des Protestantismus, deren guter Kenner Piontek war (vergl. seine 1959 herausgegebene Anthologie „Aus meines Herzens Grunde – Evangelische Lyrik aus vier Jahrhunderten“). Real ist aber auch die Gewissheit der Vergeblichkeit unseres Tuns und Lassens („was vergeblich war, wird fest unter den Sohlen“).
Das Gedicht schließt mit der (keinesfalls auftrumpfenden) Aufforderung: Wir sollen zeitig, wenn der Himmel noch im Zwielicht „mit halben Farben“ erscheint, aufstehen, um gegen den Wind anzukämpfen; weil „wir gezählte Tage leben“, sollen wir uns aber nicht beeilen. Waren die Strophen I–IV wegen ihres beschreibenden und berichtenden Charakters im Indikativ abgefasst, so wechselt Strophe V nun in den Modus eines appellativ gebrauchten Imperativs: „erwachet früh“; „sputet euch nicht“.
Die Strophen I bis III skizzieren ein Selbstbild des Verfassers und die Silhouette der kleinen Stadt, die ihm zur Heimat geworden ist. Den einfachen, kräftigen Umrisszeichnungen entsprechend herrschen darum sprachlich Aneinanderreihungen vor. Eine solche Ausdrucksweise könnte leicht ermüdend wirken. Vermieden wird es jedoch dadurch, dass am Ende von Strophe III mit „Helle von Silberkörnern / wenn die Flussnebel fallen“ ein Gegengewicht zu einer bloßen Enumeration gesetzt wird und eine Art Pause zwischen den drei ersten beschreibenden und der reflektierenden vierten Strophe entsteht. Eine ausgeprägt starke, Rhythmisierung wirkt ebenfalls gegen die sich bei Aufzählungen oft einstellende Monotonie. Weiterhin verhindern Alliterationen und Assonanzen (Beispiele aus Strophe I: „unbezähmbar“ – „Zorn“ – „Entzücken“; – „Narben“ – „scharf „– „Schlaf“) jede Gleichförmigkeit. In der appellativen Strophe V führt eine Parenthese mit anschaulichen Bildern („wenn der Morgen mit halbe Farben erscheint“; „satt das Holz leuchtet“) dazu, dass die beiden Imperative voneinander getrennt und damit in ihrem Gewicht gemindert werden.
Auf seine Lauinger Zeit zurückblickend schrieb Piontek ein Gedicht, das erst einmal s e i n bisheriges Leben zur Sprache bringt und dessen Reiz unter anderem auch in einer überzeugenden Verortbarkeit liegt. Die in der kleinen Stadt an der Donau gefundene Bleibe hat ihm ermöglicht, zur Ruhe zu kommen, die Vergangenheit zu bilanzieren und mit einer Gelassenheit, ja Unerschütterbarkeit in die Zukunft zu schauen. Gleichzeitig ist es aber auch ein Gedicht, in dem sich die Stimmungslage eines Angehörigen der zwischen 1928 und 1941 geborene Generation ausdrückt (Generation als Gruppe von Personen verstanden, die auf Grund der Gleichzeitigkeit ihres Aufwachsens und ihrer längerfristig prägender Erlebnisse und Erfahrungen gemeinsame Denkinhalte, Weltanschauungen und Verhaltensweisen besitzen). Dirk Moses hat sie als „45er“ bezeichnet und unter diesen Begriff die jungen Frontsoldaten mit sehr unterschiedlichen Kriegserfahrungen, die Flakhelfer, die kämpfende HJ-Jungen und die dem Bombenkrieg ausgesetzten Jugendlichen zusammengefasst. „Angesichts des Bankrotts der Ideale, an die viele von ihnen geglaubt hatten, der nun erkennbar werdenden Verbrechen des Staates, in dem sie sozialisiert wurden, waren sie aufgerufen, sich geistig neu zu orientieren. Was [sie] rundweg ablehnten, war politische 'Schwärmerei' Extreme Ideologien hatten keine Chancen, man pflegte das Pathos der Nüchternheit“ (Frankfurter Rundschau, 2 Juli 2002). Piontek selbst hat für diese Generation in dem Essay „Nach sieben Jahren“ folgende Worte gefunden: „Vorsicht, Misstrauen und Schweigsamkeit sollen die hervorstechendsten Eigenschaften meiner Generation sein. Sie sind uns häufig als Schwächen angekreidet worden. Ich glaube jedoch, man kann sie von Fall zu Fall auch unserer Tugenden nennen“ (H. P.: Ich höre mich tief in das Lautlose ein. S. 24), Erfolg und Anerkennung, die den Gedichten schon des jungen Piontek zuteilwurden, waren gewiss auch eine Folge davon, dass er dieser „angeschlagenen“ Generation eine Stimme gegeben hat.
Sechs Jahre nach seinen lyrischen Anfängen schrieb Piontek „Mit dreißig Jahren“, Verse, die dokumentieren, welchen beachtlichen Standard ihr Verfasser bereits erreicht hatte. Das Gedicht überzeugt durch die Einfachheit und Eingängigkeit seiner Sprache, die Genauigkeit der sparsam eingesetzten Bilder (“Helle von Silberkörner, „wenn die Flussnebel fallen“, III, Z. 7. f., „wenn der Morgen mit halben Farben erscheint“ V, Z. 2 f.), die Sicherheit in der Rhythmik von kurzen, durchweg zwei- oder dreihebigen, keinem Regelzwang unterworfenen Zeilen (vergl. nur „Keine sichtbaren Narben, / keine Medaillen, / keine Titel ...“) und zuletzt durch die Unaufdringlichkeit, jede Nötigung meidenden christlichen Bezüge.
Zum Abschluss der Interpretation soll noch einmal das eigentümliche Verhältnis des empirischen (realen) Ichs, der Person des Verfassers, und des von ihm erzeugten lyrischen Ichs als Sprecher der Verse hervorgehoben werden. Durch die erkennbare Lokalisierbarkeit und der wohl mit Bedacht erfolgten leichten Entschlüsselbarkeit biographischer Anspielungen kommt es zu einer vom Verfasser implizit herbeigeführten Verringerung der Distanz zwischen biographischer Authentizität und poetischer Fiktionalität. Dennoch bleibt ein nicht völlig zu überwindender Abstand zwischen den beiden „Ichs“ des Gedichts. Aus den Versen lassen sich nicht „blank“ persönliche Erlebnisse ihres Verfassers rekonstruieren; sie besitzen vielmehr eine sich in Metrik und damit im Gewicht der verwendeten Wörter äußernde „Künstlichkeit“, die das biografisch-alltäglichen Erleben umgestaltet und überformt. So verbietet es sich z. B. II und III direkt auf bestimmte Kriegserlebnisse zu beziehen, so lange zumindest, wie nicht persönliche Dokumente aus dieser Zeit bekannt sind. (Wenn es sie überhaupt gegeben hat, werden sie im Krieg verloren gegangen sein!)
Hartwig Wiedow