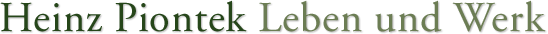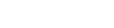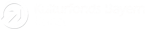Kurzinterpretation - Unablässiges Gedicht
Heinz Piontek
Unablässiges Gedicht
Geschrieben, vergessen -
am Schuh reißt der Bast
Nichts je besessen,
was du vergeudet hast.
Leuchtspur der Städte,
Orangen im Rock.
Zeit springt wie grüne Glätte
vom Rosenstock.
Vieles verschwiegen:
östliche Seen,
den Rauch und die Ziegen,
die hellen Chausseen.
Da es ersonnen:
Was gilt es dir?
Die Welt bleibt begonnen
auf dünnem Papier.
Papier, schwarz im Feuer,
ein Ruch dann von Leim,
aus Luft bald ein neuer
flüchtiger Reim.
Nichts je besessen -:
das machte dich reich.
Schreiben, vergessen
gilt gleich.
Heinz Piontek: Ich höre mich tief in das Lautlose ein. Frühe Lyrik und Prosa. Herausgegeben von Anton Hirner und Hartwig Wiedow. Berlin / Schmalkalden 2011. S. 63
Vorbemerkung: Römische Ziffern verweisen auf die Strophen des Gedichts, arabische auf die Zeilen.
Eine melancholisch gestimmte Bescheidenheit, Verzicht und Skepsis liegen über diesen Versen, und der heutige Leser wird überrascht sein, dass sie ein 28jähriger junger Mann geschrieben hat. Es ist ein Dokument einer Generation, die in de USA als „silent generation“ bezeichnet und in einem aufsehenerregenden Artikel im Time Magazine (November 1951) mit Adjektiven wie „unimaginative, withdrawn, unadventurous, and cautious“ charakterisiert wurde. 1957 fand der Soziologe Helmut Schelsky für die zwischen 1925 und 1945 Geborenen den schnell die Runde machenden Begriff der „Skeptischen Generation“. Pionteks Verse, die er 1953 (noch in einer etwas anderen Gestalt) in seinem zweiten Gedichtband „Die Rauchfahne“ veröffentlichte, lassen sich als Zeugnis dieser Generation lesen, über die er 1954 in einer kleinen autobiographischen Skizze „Nach sieben Jahren“ sagte: „Vorsicht, Misstrauen und Schweigsamkeit sollen die hervorstechendsten Eigenschaften meiner Generation sein. Sie sind uns häufig als Schwächen angekreidet worden. Ich bin glaube jedoch, man kann sie von Fall zu Fall auch unserer Tugenden nennen.“ (H. P.: Ich höre mich tief in das Lautlose ein. S. 24)
In einem kurzen, 1955 für eine Monatszeitschrift verfassten Beitrag schrieb Piontek über das „Unablässige Gedicht“: „Ich erinnere mich, dass ich damals die beiden letzten Verse zuerst niederschrieb; sie kamen ohne Mühe, ich hatte ihren Ton seit 1angem im Ohr – eine Lautfolge, die stieg und fiel und dann schwebend verklang“ (wie vor, S. 180). Der Ausgang des Gedichts – gleichzeitig sein „inspiratorischer“ Kern – vermittelt mit seinem Wechsel von einem zweitaktigen zu einem (nahezu) eintaktigen Metrum zwar den Eindruck, als sei es abgeschlossen: „Schreiben, vergessen / gilt gleich“ (VI/2 f.); der Sprecher, so scheint es, will nichts wirklich zu Besitz haben, er glaubt damit auch nicht an sein Gedicht oder gar dessen Wirkungen. Der schwebender Charakter des Abgesangs aber könnte dennoch auf ein offenes Ende hindeuten...
Die erste Strophe nimmt in einer Art zirkuläre Bewegung den Ausklang des Gedichts als Intonation auf, verschiebt das Geschehen aber dabei von der Gegenwart in die Vergangenheit („Geschrieben, vergessen - /“), in der dann Beispiele für dieses gleichzeitige Schreiben und Vergessen gesucht werden. Bereits in I/2 verbindet sich, charakteristisch für dieses Gedicht, die reflexive mit einer bild- oder zeichenhaften Ebene. Das Gedicht wird dann in II und III mit einer Reihe flüchtiger Eindrücke aufgeladen. Orientierung suchend, bewegt sich das Du des „Unablässigen Gedichts“ – mit dem Sprecher identisch – zwischen den Orten, aber auch zwischen den Zeiten. („Da sich meine Zeiten ändern, / bin ich hier und dort. / Keine Fahrten, keine Ziele / doch von Ort zu Ort“ heißt es in dem nur wenige Jahre später entstandenen Gedicht „Orte“.) Der "Bast" an den Schuhen (I/2) evoziert die Knappheit der Nachkriegsjahre, in denen statt Leder das Gewebe unter der Borke von Bäumen und verholzten Pflanzen als Schuhmaterial verarbeitet wurde. II/1-2 spricht dann, in äußerster Reduktion, vom beginnenden Wirtschaftswunder und damit von der Überwindung des Mangels in den frühen 50er Jahren: Neonbeleuchtung zu Werbezwecken in den Städten, bereits wieder importierte Südfrüchte wie Orangen, die mit genommen werden... Zeitlich vor dieser neuen Zeit, in der das Gedicht entstand und die es mit nur wenigen, aber sinnfälligen Worten andeutet, liegt aber, wie der Kern des Rosenstocks hinter seiner abspringenden grünen Haut (II, 3-4), das Grunderlebnis der Generation Heinz Pionteks: In der dritten Strophe wird, wiederum mit größter Sparsamkeit, die Existenz eines Soldaten angedeutet, unterwegs auf den „hellen Chausseen“ (III/4) der von Deutschland überfallenen Sowjetunion, vielleicht in der östlichen Sumpf- und Seenlandschaft (III/2) des in Belarus und der Ukraine fließenden Prypjat, einem Nebenfluss des Dnjepr.
In IV und V kehrt das Gedicht auf die reflexive, im Anfang bereits angeklungene Ebene zurück. Sie sprechen von der Vergeblichkeit, das Geschehene in Verse zu bringen. Es bleibt "begonnen" (IV/3), weil die Welt sich auf „dünnem Papier“ (IV/4) nicht bannen lässt; aber aus dem verworfenen, ins Feuer geworfenen Strophen (V/1), von denen nur ein Geruch von Leim bleibt (V/2), entsteht bereits ein neues, flüchtiges Gedicht (V/3f.). Der Vorgang des Lyrikmachens führt so zu einem sich wiederholenden, einem "unablässigen Gedicht"! Der ersten kreisförmigen Bewegung, in welcher der Ausklang des Gedichts in seiner Intonation aufgenommen wurde, entspricht dabei innerhalb der Verse eine zweite: Was „vergeudet“ wurde, war nicht „besessen“ (I, 3 f), im Nicht-Besessenen aber, in der Flüchtigkeit des Augenblicks von Ort und Zeit, liegt eine besondere Art von Reichtum beschlossen (V,1f.).
Piontek bedient sich in diesem Gedicht, wie häufig in seiner frühen Lyrik, einer Versform, die in der Nachkriegsdichtung von Karl Krolow, an dem sich viele junge Lyriker schulten, favorisiert wurde. (Beispiele: „Die Schwerkraft der Zeiten / Im Schnitt des Gesichtes! / Das Blau legt auf Lippen / Patiencen des Lichtes. // ...“ - „Goldmünze Mittag, / Zu Weizengarben / Und Sicheln geworfen, / Mit Hitzenarben. // ...“). Sie kann wie folgt charakterisiert werden: Liedhafte Strophe; Wechsel zwischen männlichen und weiblichen Reimen; zwei- oder dreihebige Jamben oder auch Trochäen. Pionteks „Unablässiges Gedicht“ zeichnet sich innerhalb dieses „Schemas“ nun dadurch aus, dass es die Akzentuierung relativ frei handhabt, d. h. zwischen verschiedenen Metren „springt“ und mit einer zweisilbigen Abfolge der Betonung arbeitet, vergl. nur II (betonte Silben sind kursiviert): Leuchtspur der Städte, / Orangen im Rock. / Zeit springt wie grüne Glätte / vom Rosentock.//“ Die bei strenger metrischer Fügung häufig störende „Überbetonung“ und damit Eindeutigkeit in der „Botschaft“ wird hierdurch vermieden (vergl. als Kontrast ein Gedicht von H.P. wie „Heimweg“: „Der Zeitungsrufer / meldet die Welt, /die himmlischen Ufer / taghell erhellt“.). Durch diese metrischen Freiheiten erhält das Gedicht dann den oben erwähnten „schwebenden“ und offenen Charakter. Die (abgewandelte) Versform unterstützt also seine Aussage!
Bei den Versen des „Unablässigen Gedichts“ handelt es sich um solche über die Leidenschaft, aber auch die Vergeblichkeit des Schreibens, um ein Gedicht über das Dichten selbst. Wie bei vielen modernen Lyrikern, es sei nur an H. v. Hofmannsthals „Chandos-Brief“ und an Th. St. Eliots Sprachproblemen mit dem „Waste Land“ erinnert, kommt im "Unablässigen Gedicht" eine Skepsis gegen Dichtung, was immer auch heißt: gegen Sprache zum Ausdruck. In dem oben erwähnten Beitrag – ihm lag eine Frage der Redaktion, welches sein „liebstes eigenes Gedicht" sei, zu Grunde – antwortete Piontek mit dem „Unablässigen Gedicht“ und fuhr fort: „Vielleicht steht es mir deshalb näher als die Mehrzahl meiner Poesien, weil es über den Wert von Versen, über die Leidenschaft des Schreibens und die Haltung des Schreibenden sehr persönliche Ansichten äußert? Weil es, über das Persönliche hinaus, das problematische Metier des Dichters, seine ungewisse Existenz nicht in der üblichen Art zur Sprache bringt?“ (S. 180 f.)
Piontek hat sich in seiner Lyrik noch das eine oder andere Mal zu Fragen von Dichtung und Sprache geäußert (z.B. „Wunde der Wahrheit“, „Sprachtabus“). Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang das mit „Rätselhaft“ überschriebene Gedicht im Band „Helldunkel“ (Freiburg 1987). Es heißt dort unter Verwendung volkstümlicher Wendungen: „Und als ich dann schrieb / für Heller und Batzen -/ da, von den Dächern, / pfiffen die Spatzen. // Was? Ich verstand nicht./ Doch endlich den Satz: / Das Schwarze auf Weiße / ist für die Katz.“. Der dem „Unablässigen Gedichts“ zu Grunde liegende Impetus ist geschwunden. Geblieben ist einzig die Feststellung, dass das Schreiben „für die Katz“, der Mühe also nicht wert gewesen ist. Der Sprecher, der zum Broterwerb schreiben musste – Heller und Batzen sind (alte) Münzen! – redet von dem, was längst schon kein Geheimnis mehr ist: Er konnte mit seinem Werk die Leser nicht erreichen. Lag es nun am Werk oder an den Lesern? Darüber gibt auch die letzte Strophe keine Auskunft: „Aber für welche? / Sie schwiegen bedauernd. / Kaum seh ich jetzt eine, / umschleich ich sie lauernd.“ Anstelle der Skepsis von „schreiben, vergessen / gilt gleich“ nun eine Wissbegierde, zu erfahren, warum das Schreiben vergebens gewesen sein sollte.
Hartwig Wiedow